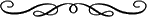Fingernägel
Renaissance
Die ursprüngliche Art Saiten anzuschlagen war wahrscheinlich das Plektrum, dass schon auf vorchristlichen Reliefs mit einer Schnur an
dem Instrument befestigt, gezeigt wird. Bei der spanischen Vihuela werden neben dem Bogen auch Plektrum- und Fingeranschlag verwendet. Der fehlende
Einsatz des Nagelspiels in der Zeit vorher hatte seine Gründe wohl auch in der mangelnden Nagelpflege:
halt dhände rein, wiltu auf der Lauten schlagen fein
Philipp Hainhofer, Lauten-Codex, 1603

Luis de Milán, Orfeo
Wie ich schon sagte, zeichnet sich der Anschlag ohne Verwendung des Nagels oder sonstiger Hilfsmittel besonders aus, weil nur im
Finger als lebendigem Teil der Geist lebt.
Miguel de Fuenllana, Orphénica Lyra, 1554, Sevilla
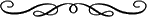
Barock

Domenico Pellegrini
Bibliothèque Nationale, Paris
Ob das Nagelspiel auf der Barockgitarre üblich war, ist nicht eindeutig zu sagen. Auf einem Gemälde, dass den italienischen Gitarristen
Domenico Pellegrini (ca.1600-1682) darstellt, kann man seine langen Fingernägel gut erkennen. Auch auf einem Bild von Antoine Watteau (1684-1721)
ist zumindest der lange Daumennagel des Gitarristen erkennbar. Deutlich nach Francisco Corbettas (1615, Pavia - 1681, Paris) Tod
erfährt man durch die Reisebeschreibungen von Adam Ebert, dass der berühmte Barockgitarrist zumindest auf dem Gipfel seines Erfolges mit
den Fingernägeln spielte.
Es war kurz zuvor der weltberühmte Guitariste Corbetto, so alle Potentaten in Europa unterrichtet, aus England alhier angekommen, weil
er aber das Malheur, daß ihm der Nagel am Finger abgebrochen, und gar langsam bey alten Leuten wieder zu wachsen pfleget, so war ihm
ohnmöglich mit seiner Musique sich bey dem Fest aufzuführen, wie sehr er es auch verlangte.
Adam Ebert (Auli Apronii), vermehrte Reisebeschreibung von Porto Franco der Chur-Brandenburg..., 1723
Zwei weitere Stimmen aus dem Barock belegen die offene Frage der Spielweise. In einem Brief an Johann Sebastian Bach beschreibt Silvius
Leopold Weiss (12.10.1687, Grottkau - 16.10.1750, Dresden), dass die Theorbe und Chitarrone im Gegensatz zur Laute mit den Nägeln gespielt
wird, was einen groben, harten Klang erzeugt. Strikt gegen das Nagelspiel ist der englische Komponist, Sänger und Lautenist Thomas
Mace (1612? - 1706?)
...take notice, that you strike not your strings with your nails, as some do, who maintain it the best way of play, but I do not; and
for this reason; because the nail cannot draw so sweet a sound from a lute, as the nibble end of the flesh can do. I confess in a
consort, it might do well enough, where the mellowness (which is the most excellent satisfaction from a lute) is lost in the crowd;
but alone, I could never receive so good content from the nail, as from the flesh: However (this being my opinion) let others do, as
seems best to themselves.
Thomas Mace, Musick's Monument, 1676, London
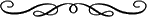
Klassik
Während der Zeit der Klassik waren die Gitarristen unterschiedlicher Auffassung über die Anschlagtechnik. Fernando Sor, Matteo Carcassi und
vor allem Antoine Meissonnier lehnten das Nagelspiel ab, Dionisio Aguado, Mauro Giuliani und Ferdinando Carulli waren dessen Vertreter. Aguado
ließ sich immerhin von seinem Freund Sor dazu inspirieren, den Daumennagel abzuschneiden:
Wir können entweder mit den Nägeln oder mit den Fingerkuppen der rechten Hand spielen. Was mich betrifft, habe ich immer meine
Nägel benutzt. Nichtsdestoweniger entschloss ich mich, meinen Daumennagel abzuschneiden, nachdem ich meinen Freund Sor spielen hörte,
und ich beglückwünschte mich, seinem Beispiel gefolgt zu sein. Der Impuls der Daumenkuppe für die Bässe erzeugt einen vollen und
angenehmen Ton. Für den Zeige- und Mittelfinger behalte ich die Nägel bei. Meine lange Erfahrung dürfte mich berechtigen, meine
Meinung zu dieser Frage darzulegen. Mit den Fingernägeln erzielen wir auf der Gitarre eine Farbe, die sich weder mit dem Klang
der Harfe noch mit dem der Mandoline vergleichen lässt. Meines Erachtens ist die Gitarre mit einem Charakter gekennzeichnet, der
sie von anderen Instrumenten unterscheidet: sie ist süß, harmonisch, pathetisch, manchmal majestätisch. Sie hat nicht Zugang zur
Erhabenheit der Harfe oder des Klaviers. Ihre zarte Anmut und ihre Vielfalt an Klangmodulationen machen sie hingegen zu einem
Instrument voll von Geheimnissen. Aus diesem Grunde halte ich es für wünschenswert, die Saiten mit den Nägeln anzuschlagen. Sie
erzeugen einen klaren, metallischen, mannigfaltigen Ton voll Zartheit, mit Licht und Schatten...
Dionisio Aguado, Nuevo Método para Guitarra, Paris, 1843
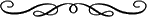
Moderne
Das Spiel in Konzertsälen erforderte eine Lautstärke, die nicht nur durch neue Gitarrenbautechnik erzielt werden konnte, sondern auch durch den
Nagelanschlag. Francisco Tárrega wechselte zwischen Nagel- und Kuppenspiel, was aber vermutlich einer Krankheit der Nagelbetten
geschuldet war.
Tárrega hatte sehr zerbrechliche Nägel, und am Ende seines Lebens gab es für ihn kein anderes Mittel mehr, als die Nägel wegzulassen. Aber bis dahin hatte er mit Nägeln gespielt. Diesen Wechsel haben sowohl Pujol als auch Fortea zum System gemacht. Mir scheint das ein ungeheurer Irrtum zu sein, denn es ist, als wollte man barfuß Zapateado tanzen.
Regino Sainz de la Maza (Fortea-Schüler), Gitarre & Laute, Heft 3/1981
Auch wenn Miguel Llobet und Andrés Segovia dem Nagelspiel den Weg bereiteten, wurde das Kuppenspiel von Schülern Tárregas zur Schule erhoben:
...Im Ateneo hörte ich vor einigen Wochen einen jungen andalusischen Gitarristen, dessen richtigen Namen ich nicht kenne, der aber den Namen Segovia angenommen haben muß, um größere Aufmerksamkeit zu erregen. Er spielte ein geschmackloses Programm, in welchem er neben den Transkription des Meisters (Tarrega) bei deren Interpretation er sich überdies unverzeihliche Freiheiten herausnahm, die Stirn hatte, eigene (Transkription) zu spielen. Seine Gelöstheit und Selbstsicherheit haben das Publikum überrascht und geblendet... und nach anfänglicher Zurückhaltung haben sie ihm seinen Applaus gegeben. Dies war aber kein spontaner Erfolg, und schon gar kein berechtigter... Zusammenfassend kann ich sagen, daß er nicht den geringsten Schimmer von der heiligen Schule unseres geliebten Tarrega hat. Bereits auf den ersten Blick kann man seine äußerst achtlose Handhaltung erkennen, und wenn er schnelle und saubere Läufe in schwierigen Passagen zustandebringt, dann nicht dank der Beachtung der korrekten Regeln, sondern nur aufgrund irgendeiner fehlbaren Intuition. Schließlich, lieber Vater, spielt er mit den Fingernägeln, das ist das Schlimmste.
Brief eines Tárrega-Schülers an Pater Cortes nach der Premiere von Andrés Segovia
(aus Joerg Sommermeyer, Nova Giulianiad)
(aus Joerg Sommermeyer, Nova Giulianiad)
Mittlerweile spielen fast alle Konzertgitarristen mit den Fingernägeln, was möglicherweise auch auf der singulären Rolle Segovias beruht. Die
offene Frage ist heute eher die Form, die man den Nägeln gibt. Segovia zumindest hatte eine eindeutige Meinung zu der Frage:
Es ist absolut verrückt. Man reduziert die Lautstärke der Gitarre und die Möglichkeiten des Timbres und der Klangfarbe. Tárrega verzichtete auf die wirkliche Natur der Gitarre, welche der Reichtum seiner Timbre und verschiedenen Klangfarben ist.
Andrés Segovias Antwort auf die Frage nach dem Kuppenspiel Tárregas.
Die emotionalste Antwort auf die Frage der Spielweise lieferte aber Emilio Pujol:
Der Ton einer mit der Fingerkuppe angeschlagenen Saite besitzt eine innerliche Schönheit, die tiefste Gefühle unserer
Empfindsamkeit anrührt, gerade so wie Luft und Licht den Raum durchdringen. Die Töne sind unkörperlich, als wären sie Töne einer
idealen ausdrucksvollen und zur Geltung kommenden Harfe. Sie haben ebenso wie den vertraulichen Charakter etwas von der römischen
Stärke und der griechischen Ausgeglichenheit. Es widerhallt die Gravität einer Orgel und die Ausdruckskraft eines Violincellos.
Die Gitarre hört auf weiblich zu sein und wird ein Instrument ernster Männlichkeit. Schließlich steht diese Art und Weise für die
ohne Verunreinigung ermöglichte Übermittlung unserer tiefsten Gefühle.
Emilio Pujol, 1960